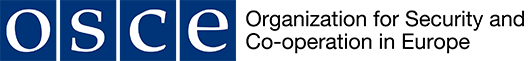Das Werden der Schlussakte von Helsinki – eine Betrachtung aus Belgrad
Als die erste Phase der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Juli 1973 in Helsinki zu Ende ging, war jedem bewusst, dass dies ein erster historischer Schritt zur Beendigung des Kalten Kriegs war. Doch die Schlussakte von Helsinki war noch nicht geschrieben. Das Übereinkommen, der künftige Grundpfeiler der Europäischen Sicherheit, entstand erst in der zweiten Phase der Konferenz, die nicht in Finnland, sondern in Genf (Schweiz) vom 18. September 1973 bis 1. August 1975 stattfinden sollte.
Es war ein neues Experiment in den internationalen Beziehungen. Die Geschäftsordnung sah vor, dass die Stimme eines jeden Landes dasselbe Gewicht hatte und daher jedes Land berechtigt war, sein Veto einzulegen. Es gab mehr als tausend Vorschläge. Der Osten lag im Wettstreit mit dem Westen darüber, wer mehr Standpunkte durchbringen würde. Die neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten vermittelten, vertraten zugleich aber auch ihre eigenen Anliegen.
Vladimir Bilandžić war damals ein junger Research Fellow für internationale Politik und Wirtschaft in Belgrad. Er war als Experte für internationale Sicherheit den größten Teil des zweiten Jahres Mitglied der Delegation Jugoslawiens bei den Genfer Verhandlungen. Er erinnert sich an die Dynamik der Verhandlungen und daran, dass Jugoslawien besonders daran gelegen war, eine „weltweite Dimension“ in das Übereinkommen über europäische Sicherheit einzubringen.
Wie waren die Genfer Treffen organisiert?
Die Treffen in Genf fanden erst in der Villa Moynier in der Nähe des Palais des Nations statt, ehe sie in die Räumlichkeiten der Internationalen Arbeitsorganisation und schließlich in das neue internationale Konferenzzentrum in Genf übersiedelten. Sie waren ein Potpourri aus formellen und informellen Zusammenkünften. Die Plenarsitzungen fanden einmal pro Woche statt, später, als die Verhandlungen dem Ende zugingen, auch häufiger, da die Delegationsleiter über die umstrittensten Formulierungen des Textes zu einem Kompromiss kommen mussten.
Es gab einen Ausschuss zu jedem der drei Körbe – zu Sicherheit und den Grundprinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten (der sogenannte Helsinki-Dekalog), zu Wirtschafts- und Umweltfragen und zu humanitären Angelegenheiten. Es gab auch eigene Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, wie etwa zum Mittelmeerraum und zur Nichtanwendung von Gewalt. Ein Großteil der Verhandlungen wurde eigentlich außerhalb des Konferenzsaals in den Nebenräumen geführt; die langen Kaffeepausen wurden dann für informelle und bilaterale Verhandlungen genutzt.
Im letzten Monat der Verhandlungen, also im Juni 1975, dauerten die Verhandlungen oft bis spät nachts, doch gab es vor diesem Sommer auch Phasen, in denen es gemächlicher zuging. Natürlich waren da auch andere internationale Ereignisse, die sich auf die Diskussionen auswirkten – wie etwa das Ende des Vietnamkriegs –, aber die Verhandlungen gingen unbeeinflusst von diesen größeren Entwicklungen weiter.
Grundsätzlich gab es drei Gruppen von Staaten – die westlichen Staaten, die Sowjetunion und die Mitglieder des Warschauer Paktes und die neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten. Zu letzterer Gruppe gehörten vier neutrale Staaten und Jugoslawien, zu denen sich später noch Malta und Zypern gesellten. Das ebenfalls neutrale Irland war jedoch nicht Mitglied dieser Gruppe.
Welche Rolle hatten die neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten?
Anfangs war es hauptsächlich eine Vermittlerrolle, die gefragt war, wenn ein Mittelweg zwischen den beiden Blöcken gefunden werden musste. Später vertrat die Gruppe dann auch ihre eigenen Interessen und brachte eigene Vorschläge ein, darunter einen über vertrauensbildende Maßnahmen.
Es gab einen Prozess für die Einigung auf gemeinsame Standpunkte. Die Gruppe war heterogen, ihr Bereich gemeinsamer Interessen beschränkte sich anfangs hauptsächlich auf militärische Sicherheit und verwandte Fragen, wurde aber später größer. Einige Länder, wie Österreich, die Schweiz und Schweden, übernahmen eine führende Rolle bei den Menschenrechten. Da Jugoslawien damals kein demokratisches Land mit einem Mehrparteiensystem war, konnte es sich nicht so weit vorwagen, wie andere. Trotzdem war da ein gemeinsamer Nenner, wie beispielsweise bei den Rechten nationaler Minderheiten.
Jugoslawien förderte die „Weltdimension“, wie man sie damals salopp nannte. Es bestand darauf, dass man die Sicherheit in Europa nicht losgelöst von der Sicherheit in anderen Regionen sehen könne, dass Europa keine Insel des zivilisierten Umgangs miteinander sein könne, wenn der Rest der Welt in Unterentwicklung und Konflikten stecken bliebe. Daher vertrat es die Auffassung, diese „Weltdimension“ oder, anders gesagt, ein globaler Ansatz, sollte in den Text der Schlussakte von Helsinki Eingang finden. Und tatsächlich enthielten dann einige Bestimmungen Formulierungen in diesem Sinne. So anerkannten die Teilnehmerstaaten etwa in der Einleitung zur Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, „die Notwendigkeit, dass jeder von ihnen seinen Beitrag zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt leistet“. Und unter Prinzip IX (Zusammenarbeit zwischen den Staaten) ist festgelegt, dass sie „das Interesse aller berücksichtigen werden, insbesondere das Interesse der Entwicklungsländer in der ganzen Welt, Unterschiede im Stand der wirtschaftlichen Entwicklung zu verringern“. Ein weiteres Beispiel dafür findet sich in dem Abschnitt zu den Fragen im Zusammenhang mit der Abrüstung; dort heißt es, dass die Teilnehmerstaaten davon überzeugt sind, dass wirksame Maßnahmen auf diesem Gebiet „zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in der ganzen Welt führen sollen“.
Natürlich hat sich das alles nach dem Fall der Berliner Mauer und den nachfolgenden Entwicklungen in Europa, der Auflösung Jugoslawiens und der Erweiterung der Europäischen Union geändert. Ich halte es jedoch nach wie vor für interessant, die Dynamik der damaligen Verhandlungen zu analysieren.
Wie haben die Verhandlungen in der Praxis funktioniert?
Ganz generell galt die Regel, dass im Wortlaut der Schlussakte von Helsinki „nichts als vereinbart gilt, solange nicht alles vereinbart ist“. Dieser Satz wurde immer wieder ins Treffen geführt. Das hieß theoretisch, dass das gesamte Dokument nicht als vereinbart galt, wenn nur ein einziger Absatz nicht verabschiedet worden wäre. Das war tatsächlich das damalige Konzept.
Und so war der Text dann auch übersät mit Klammern. Wenn eine Delegation sah, dass man sich auf einen bestimmten Teil des Wortlauts nicht einigen konnte, dann schlug sie einfach vor, den betreffenden Textteil in Klammern zu setzen, weiterzumachen und zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückzukommen, um die Verhandlungen nicht zu unterbrechen. Man entwickelte eine gewisse Meisterschaft in der Verwendung von Klammern, die so weit ging, dass zeitweise mehr Text in den Klammern stand, als außerhalb. Manchmal kreiste die Diskussion um die Kommata in einem Satz – wie zum Beispiel beim Prinzip über die Unverletzlichkeit der Grenzen und bei der Frage, wie Grenzen mit friedlichen Mitteln verändert werden können. Als die Verhandlungen dem Ende zugingen, stellte sich die Frage der verschiedenen Sprachfassungen, der Übersetzung des Englischen, in dem der Text ja verfasst war, ins Russische, Deutsche, Französische, Italienische und Spanische. Einige Delegationen hatten Sorge, dass eine Verpflichtung im Englischen präziser formuliert sein könnte als in anderen Sprachfassungen.
Es waren äußerst komplizierte Verhandlungen. Manche Teile des Dokuments hingen von anderen ab. Der Konsens zu einem Satz oder Prinzip war mit der Zustimmung zu einem anderen Satz oder Prinzip verknüpft. Häufig gab es das, was wir als Paketlösung bezeichneten, sogar über die Grenzen eines Korbes hinweg.
Doch die Konsensregel stand außer Streit – sie wurde unter allen Umständen eingehalten. So konnte jede Delegation, sogar die kleinste, in Vertretung des kleinsten Landes, einen Beschluss verzögern oder blockieren. Das geschah dann auch tatsächlich kurz vor dem eigentlichen Ende, als der ganze Wortlaut der Schlussakte von Helsinki beschlossen werden sollte und Malta auf einer Formulierung betreffend den Mittelmeerraum bestand und dadurch die Konferenz für fast zwei Tage blockierte, so lange, bis eine Kompromissformel gefunden wurde. Das machte damals Schlagzeilen in allen Zeitungen.
Dann gab es auch noch einen sehr kreativen Umgang mit den Zeigern der Uhr am letzten Abend der Verhandlungen, als um Mitternacht die Frist für die Einigung über den Text der Schlussakte verstrich. Man hielt einfach die Zeiger der Uhr im Konferenzsaal an und damit die Fiktion aufrecht, der Text wäre innerhalb der gesetzten Frist verabschiedet worden.
Aus heutiger Sicht scheinen zwei Jahre für die Aushandlung eines Dokuments vielleicht eine sehr lange Zeit, aber man muss sich vor Augen halten, dass die Schlussakte von Helsinki anfangs nicht mehr war als ein fast unbeschriebenes Blatt Papier. Auf die Grundprinzipien hatte man sich in Helsinki im Zuge des Vorbereitungstreffens bereits geeinigt, nicht jedoch auf den Wortlaut selbst. Daher sind zweijährige Verhandlungen keine so lange Zeit für ein Dokument von der Tragweite der Schlussakte von Helsinki.
Wie fällt ein Vergleich der damaligen und der heutigen Verhandlungen in der OSZE aus Ihrer Sicht aus?
Damals wie heute ist die Konsensregel ehernes Gesetz – daran hat sich nichts geändert. Europa ist heute, trotz aller Schwierigkeiten, offensichtlich wesentlich geeinter als damals. In jener Zeit war man sich allgemein der Tatsache bewusst, damit in den internationalen Beziehungen Neuland betreten zu haben. Allen Teilnehmerstaaten war es ein Anliegen, ein Dokument auszuarbeiten, das die Sicherheit in Europa stärken würde; niemand wollte ein Scheitern der Vereinbarung riskieren. Rückblickend gesehen, glaube ich, dass die Konferenz gar nicht anders konnte, als ein Erfolg zu werden. Aber es war kein leichter Erfolg. Die politischen Systeme waren damals sehr verschieden, ebenso die Wertesysteme.
Es gab vielleicht eine Tendenz, die Dinge – ich möchte nicht sagen, ernster zu nehmen, aber Worte hatten damals großes Gewicht. Jeder Satz wurde auf die Waagschale gelegt. Das war durchaus üblich, wurde aber auch zu einer Art Wettbewerb zwischen den beiden Seiten, bei dem es darum ging, wessen Interessen den Sieg davon tragen würden. Es war auch eine Rivalität der Ideologien, und in manchen Kreisen wurde das ganze Unternehmen mit Skepsis betrachtet. Daher musste man die Hauptstädte, die Menschen daheim, davon überzeugen, dass der Prozess insgesamt Vorteile bringen würde.
Alles, was die OSZE von heute ausmacht, war bereits in irgendeiner Form in der Schlussakte von Helsinki enthalten. Viele operative Bestimmungen haben heute keine Bedeutung mehr, aber die Grundprinzipien sind nach wie vor gültig und die Grundwerte, wie die Menschenrechte oder die souveräne Gleichheit der Staaten, sind nach wie vor weitgehend eine Frage von Legitimität, wenn es um die friedliche Regelung von Streitfällen geht. Auch die militärischen vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, die zwar im Vergleich zu den heutigen bescheiden anmuten, waren wirklich bahnbrechend, da sich damit Länder erstmals dazu verpflichteten, militärische Manöver vorher anzukündigen, um Missverständnisse zu vermeiden und Risiken zu vermindern.
Eines der wichtigsten Dinge jedoch, ohne die sich die OSZE nicht zu der internationalen Organisation entwickelt hätte, die sie heute ist, war selbstverständlich die Übereinkunft, den Prozess fortzusetzen. Als die Konferenz begann, stand keineswegs fest, dass alle Staaten bereit sein würden, weiterzumachen. Einige waren der Auffassung, die Schlussakte von Helsinki sollte der Endpunkt der ganzen Sache sein. Doch dann wurde beschlossen, ein Folgetreffen abzuhalten – in Belgrad. Weshalb ausgerechnet Belgrad? Jugoslawien gehörte zur Gruppe der neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten und hatte (anders als die Schweiz und Finnland) bis dato noch keine Veranstaltung ausgerichtet. Es war auch in der blockfreien Bewegung im Rahmen der Vereinten Nationen sehr aktiv und hatte damals starke Bande zum Mittelmeerraum. Die Genfer Verhandlungen über die Schlussakte von Helsinki waren also ein Anfang und kein Endpunkt, was ich für überaus wichtig halte.
Nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki nahm Vladimir Bilandžić an KSZE‑Folgetreffen und Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen (VSBM) teil. Heute ist er nationaler Sonderberater für VSBM bei der OSZE‑Mission in Serbien.
Das ist der dritte Artikel einer Serie zur Schlussakte von Helsinki, die Sicherheitsgemeinschaft anlässlich des 40. Jahrestags dieses Grundlagendokuments der OSZE veröffentlicht. Die ersten beiden Artikel „Zurück zum Geist von Helsinki“ von Lamberto Zannier und „Zweiter Korb – wohin führt der Weg?“ von Kurt P. Tudyka erschienen in Ausgabe 1/2015 und Ausgabe 2/2015.
Weiterführende Lektüre:
Einen umfassenden Bericht über den KSZE-Prozess durch einen Teilnehmer aus dem ehemaligen Jugoslawien gibt der Artikel „Problems of Security and Cooperation in Europe“ von Ljubivoje Aćimović (Sijthoff & Noordhoff, 1981), der ursprünglich auf Serbokroatisch unter dem Titel „Problemi bezbednosti i saradnje u Evropi“ erschienen ist.
Eine Gemeinschaft bauen
Ihre Meinung
Wir freuen uns über Kommentare zu Sicherheitsthemen. Ausgewälte kommentare werden veröffentlicht. Schicken Sie Ihre Meinung an oscemagazine@osce.org
Beiträge
Schriftliche Beiträge über Aspekte aus der politisch-militärischen, wirtschaftlich und umweltlichen oder humanitären Dimension werden begrüßt. Kontaktieren Sie: oscemagazine@osce.org